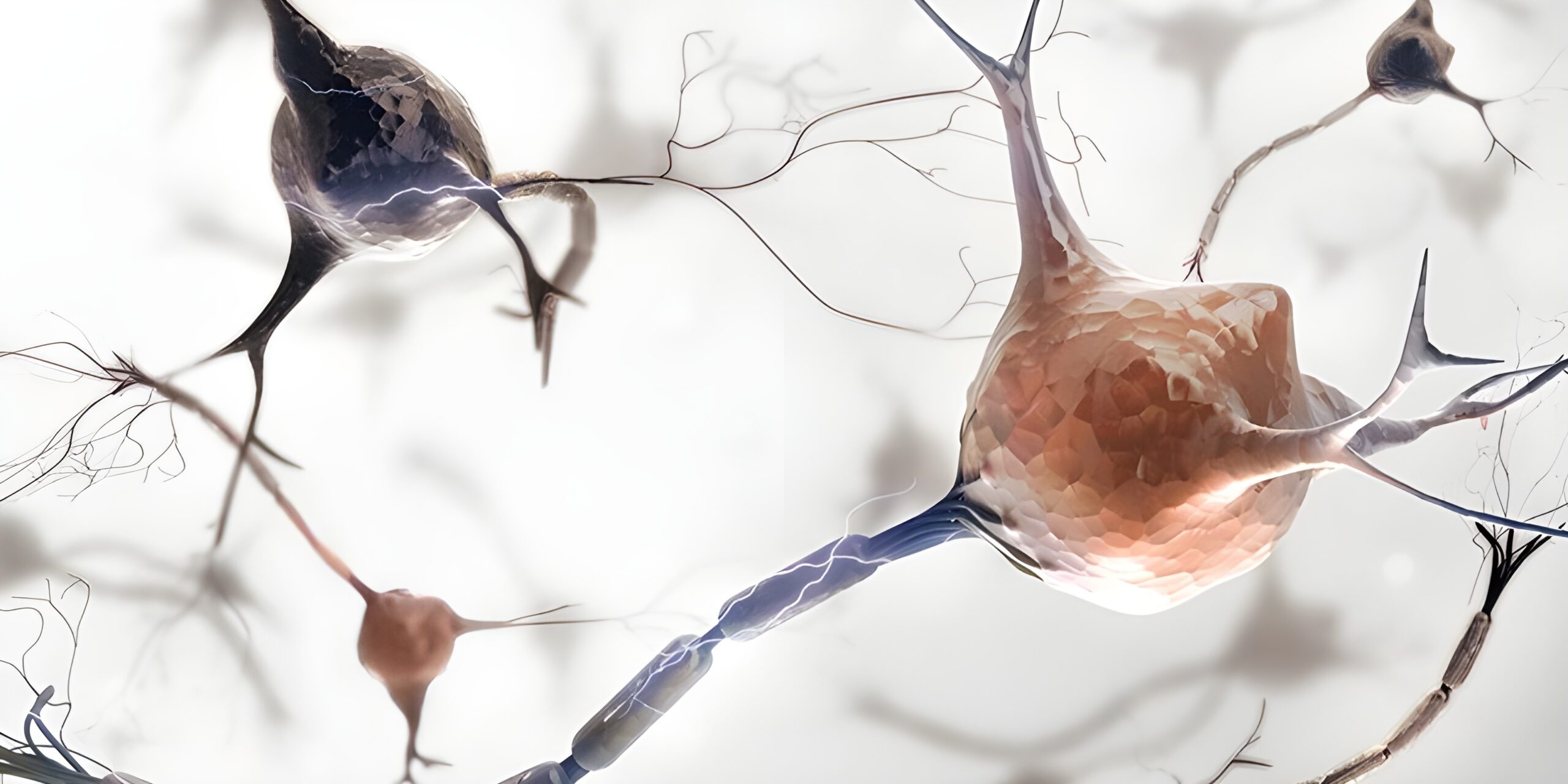Präambel: Von der Entweder-oder- zur Sowohl-als-auch-Medizin
Die moderne Psychiatrie steht an einem Wendepunkt. Mit über 970 Millionen Menschen weltweit, die von psychischen Störungen betroffen sind, und diagnostischen Übereinstimmungsraten, die bei Major Depression gerade einmal Kappa-Werte von 0,28-0,32 erreichen, ist es an der Zeit, unsere diagnostischen Werkzeuge zu erweitern. Die Hirnfunktionsanalyse (HFA) stellt dabei keine Konkurrenz zur klinischen Expertise dar, sondern deren wissenschaftliche Ergänzung – zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten.
These 1: Technologie ermöglicht tiefere menschliche Beziehung
Der Vorwurf: Die HFA sei technisch und kalt, während die traditionelle Psychiatrie und Psychologie die Menschen dort abhole, wo sie es nötig haben – auf der Beziehungsebene.
Die Realität: Gerade die objektive Sicherheit, die eine HFA bietet, schafft die Grundlage für eine tragfähigere therapeutische Beziehung. Wenn eine Mutter ihr Kind zur Abklärung bringt und nach ausführlichem Gespräch immer noch Unsicherheit herrscht, ob nun ADHS, Autismus, Angst oder eine Kombination vorliegt, belastet dies die Beziehung. Die durchschnittliche Verzögerung von 9,5 Jahren bis zur korrekten Bipolar-Diagnose bedeutet fast ein Jahrzehnt der Unsicherheit, ineffektiver Behandlungsversuche und schwindenden Vertrauens.
Die HFA funktioniert wie ein Röntgenbild: Niemand würde behaupten, ein Röntgenbild verhindere die ärztliche Beziehung zum Patienten mit Knochenschmerzen. Im Gegenteil – es schafft Klarheit und ermöglicht gezielte Hilfe. Ebenso verhält es sich mit der HFA: Sie objektiviert das, was im Gehirn geschieht, und ermöglicht dadurch präzisere Interventionen und ehrlichere Gespräche.
Die wissenschaftliche Evidenz: Studien zeigen, dass Patienten, die eine klare, biologisch fundierte Diagnose erhalten, höhere Behandlungsadhärenz und besseres Ansprechen auf Therapie aufweisen. Die Integration objektiver Biomarker erhöht das Vertrauen in diagnostische Entscheidungen – sowohl bei Behandelnden als auch bei Betroffenen. Wenn wir ehrlich sind: Was gibt einer Mutter mehr Sicherheit und Vertrauen – eine weitere subjektive Meinung oder die objektive Bestätigung durch neurobiologische Daten, die ihre Wahrnehmung validieren?
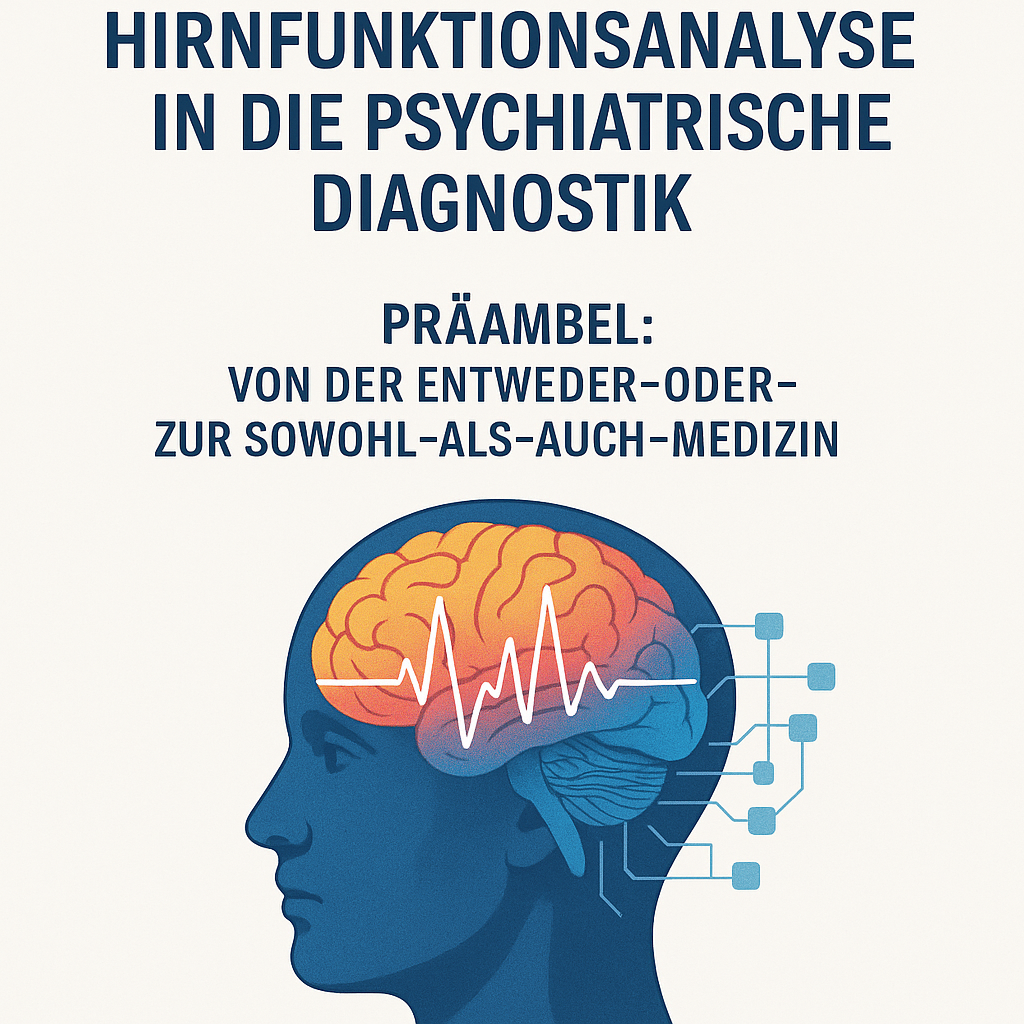
These 2: Klinische Anwendung erfordert keine vollständige Kausalitätsklärung
Der Vorwurf: Die Ursachen psychiatrischer Störungen seien noch nicht restlos geklärt, deshalb dürfe die HFA nicht angewendet werden.
Die Realität: Diese Argumentation würde die gesamte Medizin lahmlegen. Wir kennen die exakten Ursachen von Migräne, Morbus Crohn oder Multipler Sklerose nicht vollständig – dennoch behandeln wir diese Erkrankungen täglich und erfolgreich. Die Medizin hat schon immer mit Mustererkennung und empirischer Evidenz gearbeitet, lange bevor alle kausalen Mechanismen verstanden waren.
Die HFA identifiziert reliabel Muster neuronaler Aktivität, die mit spezifischen Störungsbildern assoziiert sind. Die High-Dimensional EEG Connectivity Study Group erreichte 2022 mit 4D/6D-Konnektivitätstensoren eine Klassifikationsgenauigkeit von 98,85 Prozent bei ADHS. Diese Muster sind reproduzierbar, validiert und klinisch relevant – unabhängig davon, ob wir jeden einzelnen Neurotransmitter-Rezeptor und jede genetische Variante vollständig verstehen.
Das Prinzip: Wir müssen nicht die letzte Ursache kennen, um verlässliche diagnostische Marker nutzen zu können. Entscheidend ist die empirische Validierung: Zeigt die HFA konsistent und reproduzierbar Unterschiede zwischen Patientengruppen und gesunden Kontrollen? Die Antwort der aktuellen Forschung ist eindeutig: Ja. Meta-Analysen über tausende von Patienten bestätigen dies. Die Frage ist nicht, ob die Methode wissenschaftlich fundiert ist, sondern wann wir sie endlich systematisch in die klinische Praxis integrieren.
These 3: Die Diagnose bleibt klinisch – die HFA erweitert den Blickwinkel
Der Vorwurf: Diagnosen müssten immer klinisch sein, eine technische Untersuchung könne dies nicht ersetzen.
Die Realität: Hier herrscht ein grundlegendes Missverständnis. Niemand fordert, dass die HFA die klinische Diagnostik ersetzt. Die Vision ist eine integrative, multimodale Diagnostik, die das Beste aus verschiedenen Welten vereint:
- Das ausführliche klinische Interview erfasst die subjektive Erlebniswelt, die Lebensgeschichte, die familiären Belastungen und die individuellen Ressourcen des Menschen.
- Die gründliche Anamnese zeichnet die Entwicklung der Symptomatik über die Zeit nach und identifiziert biografische Auslöser und Muster.
- Strukturierte Fragebögen standardisieren die Symptomerfassung und ermöglichen Vergleiche über die Zeit und zwischen verschiedenen Beurteilern.
- Neuropsychologische Diagnostik objektiviert kognitive Stärken und Schwächen in Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Exekutivfunktionen und sozial-emotionaler Verarbeitung.
- Die Hirnfunktionsanalyse ergänzt dieses Bild durch die direkte Messung neuronaler Aktivität und Konnektivität – sie zeigt, was im Gehirn geschieht, während die Person denkt, fühlt und handelt.
Diese fünf Säulen bilden zusammen ein umfassendes diagnostisches Fundament. Die HFA ersetzt die klinische Beurteilung nicht – sie erweitert sie um eine objektive, neurobiologische Dimension. Die finale Diagnose bleibt selbstverständlich eine klinische Gesamtbeurteilung, die alle verfügbaren Informationen integriert.
Der Paradigmenwechsel: Von Kategorien zu Dimensionen
Die Integration der HFA ermöglicht den längst überfälligen Paradigmenwechsel von rigiden diagnostischen Kategorien zu flexiblen, dimensionalen Modellen. Die Forschung zeigt: 50-70% der Menschen mit Autismus erfüllen gleichzeitig die Kriterien für ADHS, während die genetische Überlappung bei 50-72% liegt. Diese hohen Komorbiditätsraten sind kein diagnostisches Versagen – sie spiegeln die biologische Realität wider.
Die HFA erlaubt es uns, diese Überlappungen präzise zu erfassen und individuelle neurobiologische Profile zu erstellen. Zwei Patientinnen mit derselben DSM-5-Diagnose können völlig unterschiedliche Hirnfunktionsmuster aufweisen – und entsprechend unterschiedlich auf Behandlungen ansprechen. Die HFA macht diese Unterschiede sichtbar und ermöglicht personalisierte Therapieplanung.
Die ökonomische und ethische Verpflichtung
Die gesundheitsökonomische Evidenz ist überwältigend: EEG-basierte Biomarker-Systeme amortisieren sich innerhalb eines Jahres. Pro 1000 Patienten bedeutet eine Investition von 296’518 Franken über fünf Jahre Einsparungen von 1,5 Millionen Franken – ein Netto-Gewinn von 1,2 Millionen Franken. Nach dem ersten Jahr generiert jeder diagnostizierte Patient kontinuierlich 1500 Franken Einsparungen pro Jahr durch präzisere Behandlung und vermiedene Hospitalisierungen.
Doch es geht um mehr als Geld. Es geht um Menschenleben. Es geht um das autistische Mädchen, das erst mit 13 Jahren diagnostiziert wird, statt mit 8 – fünf verlorene Jahre, in denen Unterstützung hätte greifen können. Es geht um den jungen Mann mit Bipolar-Störung, der 9,5 Jahre auf die korrekte Diagnose wartet und in dieser Zeit ineffektive Antidepressiva erhält, die seine Manie verschlimmern. Es geht um die Mutter mit Depression, die nach dem vierten erfolglosen Medikamentenversuch das Vertrauen in die Behandlung verliert.
Wir haben die wissenschaftlichen Werkzeuge, um diese diagnostischen Odysseen zu verkürzen. Wir haben die ökonomischen Argumente für ihre Implementation. Die Frage ist: Haben wir den ethischen Willen, sie einzusetzen?
Praktische Integration: Evolution statt Revolution
Die erfolgreiche Integration der HFA erfordert keinen radikalen Bruch mit bewährten klinischen Praktiken, sondern deren systematische Erweiterung:
Phase 1 – Indikationsstellung: Nach dem ausführlichen klinischen Erstgespräch und der Anamnese entscheidet die Fachperson, ob zusätzliche objektive Daten die diagnostische Sicherheit erhöhen würden. Bei komplexen Fällen, unklaren Komorbiditäten oder atypischen Präsentationen ist die HFA besonders wertvoll.
Phase 2 – Durchführung: Die HFA wird durch geschultes Personal durchgeführt, während die Fachperson die übrige Diagnostik fortsetzt. Es entstehen keine unnötigen Wartezeiten.
Phase 3 – Integration: Die HFA-Befunde werden gemeinsam mit allen anderen diagnostischen Informationen in einer Gesamtbeurteilung integriert. Widersprüche zwischen klinischem Eindruck und HFA-Befund werden thematisiert und können zu vertieften Explorationen führen.
Phase 4 – Verlaufskontrolle: Die HFA ermöglicht objektives Monitoring des Behandlungsverlaufs und frühzeitige Identifikation von Rückfällen oder Nebenwirkungen.
Schlusswort: Die Zeit ist reif
Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig. Die ökonomische Rechtfertigung ist überwältigend. Die ethische Verpflichtung gegenüber unseren Patientinnen und Patienten ist klar. Die Hirnfunktionsanalyse ist keine Konkurrenz zur klinischen Psychiatrie und Psychologie – sie ist deren natürliche Weiterentwicklung im 21. Jahrhundert.
Wir stehen vor der Wahl: Bleiben wir bei diagnostischen Übereinstimmungsraten von 28-32% und verlängern damit das Leid unserer Patienten? Oder integrieren wir die verfügbaren wissenschaftlichen Werkzeuge in eine moderne, multimodale Diagnostik, die dem Menschen in seiner biologischen und psychologischen Komplexität gerecht wird?
Die Vision einer Neurodiversitäts-Medizin, die den Menschen in seiner Einzigartigkeit erfasst und optimal unterstützt – nicht durch Normalisierung, sondern durch massgeschneiderte Interventionen – ist keine ferne Utopie mehr. Sie ist heute wissenschaftlich möglich, ökonomisch sinnvoll und ethisch geboten.
Die Zeit für objektive psychiatrische Diagnostik ist jetzt.
Gehirn- und Traumastiftung Graubünden
Biomarker Workshop 2025 | 11. Dezember 2025 | Zürich
Weitere Informationen: https://gtsg.ch/de/biomarker-workshop-2025-2/